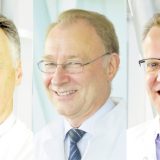Mit kleinen Schnitten gegen Speiseröhrenfehlbildungen

Im Gespräch mit Professor Dr. med. Guido Fitze, Direktor der Klinik für Kinderchirurgie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
Eines von 3.500 Neugeborenen kommt mit einer Fehlbildung der Speiseröhre zur Welt. Die Kinder sind so nicht normal ernährbar, sodass oft Nahrung von der Speise- in die Luftröhre gelangen kann. Starben noch vor 50 Jahren fast alle Babys mit einer solchen Anomalie, gibt die moderne Medizin heute Hoffnung. Es ist nicht mal mehr zwangsweise ein Schnitt am Brustkorb nötig. Die Klinik für Kinderchirurgie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden nutzt als eine von deutschlandweit sehr wenigen Kliniken minimalinvasive Operationstechniken, um die Speiseröhre zu rekonstruieren. Wir sprachen mit Klinikdirektor Prof. Dr. med. Guido Fitze über die Methode.

v.l.: Dr. med. Christian Kruppa (leitender Oberarzt) und Prof. Dr. med. Guido Fitze (Direktor der Klinik für Kinderchirurgie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden). / Foto: Thomas Albrecht
Wie häufig kommen Fehlbildungen der Speiseröhre bei Neugeborenen vor?
Professor Dr. med. Guido Fitze: Wir müssen davon ausgehen, dass in der Kinderchirurgie fast alle Anomalien zu den seltenen Erkrankungen zählen. Man spricht dabei von einer Häufigkeit, die kleiner als 1:5000 ist. Bei der Speisröhrenfehlbildung kann man davon ausgehen, dass in Sachsen bei einer Geburtenzahl von 35.000 Neugeborenen ungefähr zehn bis zwölf Kinder betroffen sind. Davon behandeln wir an der Klinik für Kinderchirurgie etwa sechs bis acht im Jahr. Das sind natürlich kleine Zahlen, verglichen mit der Allgemeinchirurgie. Im Vergleich dazu ist die häufigste Operation, die man mit minimalinvasiven Techniken in der Kinderchirurgie durchführt, die Blinddarm-Entfernung.
Kann man Ursachen für die Speiseröhrenfehlbildung identifizieren, und wie entsteht die Anomalie?
Konkrete Ursachen zu identifizieren, ist schwierig. Wir wissen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass die Anomalien nicht vererbbar, sondern spontane Fehlbildungen sind. Sie entstehen durch eine Trennungsstörung im embryonalen Vorderdarm. Speiseröhrenfehlbildungen haben sehr häufig eine Verbindung zur Luftröhre, eine sogenannte Fistel. Diese entsteht bei der Ausstülpung der Lunge aus dem Vorderdarm. Die Gefahr besteht dann darin, dass Nahrung von der Speiseröhre in die Luftröhre gelangt.
Wie diagnostiziert man die Erkrankung?
Tückisch an der Krankheit ist, dass man sie meist nicht pränatal diagnostizieren kann. Es gibt höchstens Hinweise, etwa wenn der Fötus einen zu kleinen Magen oder die Mutter zu viel Fruchtwasser hat. Deswegen sind es meistens Zufallsbefunde, wenn wir eine Speiseröhrenfehlbildung diagnostizieren. Oft bemerkt man es beim Stillen, wenn die Kinder sich verschlucken, weil Muttermilch oder Speichel in die Lunge kommt. Dann liegt der Verdacht nahe, dass eine Speiseröhrenfehlbildung vorliegt. Vor der Wende war die Diagnose oft schnell gestellt. Nach der Geburt wurde obligatorisch die Speiseröhre sondiert und Magensaft bei Neugeborenen entnommen. Wenn dann ein saurer pH-Wert vorlag, konnte man davon ausgehen, dass keine Speiseröhrenfehlbildung existierte. Gelang dies jedoch nicht, war die Diagnose praktisch gesichert.
Angesichts der Tatsache, dass nur sehr wenige Kliniken die minimalinvasive Speiseröhren-Rekonstruktion bei Neugeborenen anbieten: Seit wann nutzen Sie minimalinvasive Operationstechniken? Welche spezifischen Kompetenzen muss der Operateur mitbringen?
Wir führen die Operationen jetzt seit drei Jahren durch, wobei wir auch eine gewisse Lernphase durchschreiten mussten. Man muss die Prinzipien minimalinvasiver Operationstechniken und daraus folgend natürlich den Umgang mit den entsprechenden Instrumenten beherrschen. Entscheidend ist, dass man bei der Anwendung dieser Methoden den Schritt vom reinen Resezieren hin zum rekonstruktiven Operieren bewältigt. Ein Nachteil der Methoden ist dabei, dass der Eingriff an sich weitgehend eine Einmannshow ist. Das Zusammenspiel aller beteiligten Akteure am Tisch ist natürlich wichtig, aber die eigentliche Operation konzentriert sich auf eine Person. Das ist deutlicher ausgeprägt als bei konventionellen Operationen, bei denen man sich eher gegenseitig helfen kann.
Wie haben Sie die Techniken gelernt?
Ich habe eine Weile in Triest bei einem Kollegen hospitiert, der sehr versiert in den minimalinvasiven Techniken ist. Ansonsten zieht man Videomaterial zu Rate, um die Beispiele gedanklich umzusetzen. Zudem gibt es Trainingslabore, wo an Modellen geübt wird. Auch an Kleintiermodellen wird trainiert, so dass man an die kleineren Strukturen in der Kinderchirurgie herangeführt wird. Top: Welche Rolle spielen technologische Entwicklungen vor diesem Hintergrund? Professor Fitze: Man darf nicht verkennen, dass die medizintechnische Entwicklung in den letzten Jahren immer mehr in Richtung Miniaturisierung tendiert. Vor zehn Jahren war ein 5 Millimeter großes Instrument noch etwas Besonderes. Bei der Rekonstruktion der Speiseröhre nutzen wir eine Kamera mit einer 5 Millimeter Optik, die uns hochauflösende, vergrößerte Bilder ermöglicht. Die Instrumente, mit denen wir operieren, sind 3 Millimeter groß. Das ist eine unbedingte Voraussetzung, so dass man sich in dem kleinen Brustkorb eines Neugeborenen bewegen kann. Wir trennen den unteren Teil der Speiseröhre von der Luftröhre, öffnen dann den verschlossenen oberen Teil und fügen beide zusammen. Durch die Verkleinerung der Lunge mittels moderaten CO²-Drucks schaffen wir uns dabei zusätzlichen Raum.
Bestehen Risiken durch die CO²-Belastung?
Die Dauer der Operation darf nicht zu lang werden. Die CO²-Belastung des Kindes gilt es auf keinen Fall zu vernachlässigen. Aber aus den Erfahrungen haben wir gelernt, dass minimalinvasive Operationen nicht wesentlich länger sind als konventionelle Eingriffe. Man operiert ungefähr 1,5 bis 2Stunden. Das ist absolut zumutbar. Die angeblich längere Operationsdauer ist aus unserer Sicht also kein Argument gegen die minimalinvasiven Methoden. Top: Wie geht man im Vergleich dazu bei konventionellen Operationen vor und was sind die Vorteile der minimalinvasiven Methode? Professor Fitze: Beim herkömmlichen Verfahren müssen die Chirurgen die Rippen stark spreizen, um bis zur Speiseröhre vordringen zu können und genügend Bewegungsfreiheit zu haben. Im Gegensatz dazu werden bei der minimalinvasiven Methode Schnitte durch Gewebe und Gefäße vermieden. Die Neugeborenen benötigen während und nach der Operation weniger Schmerzmittel und erholen sich deutlich schneller. Außerdem werden nach konventionellen Operationen am Brustkorb im späteren Verlauf häufig Deformitäten beobachtet.
https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-institute/kch
Interview: Philipp Demankowski