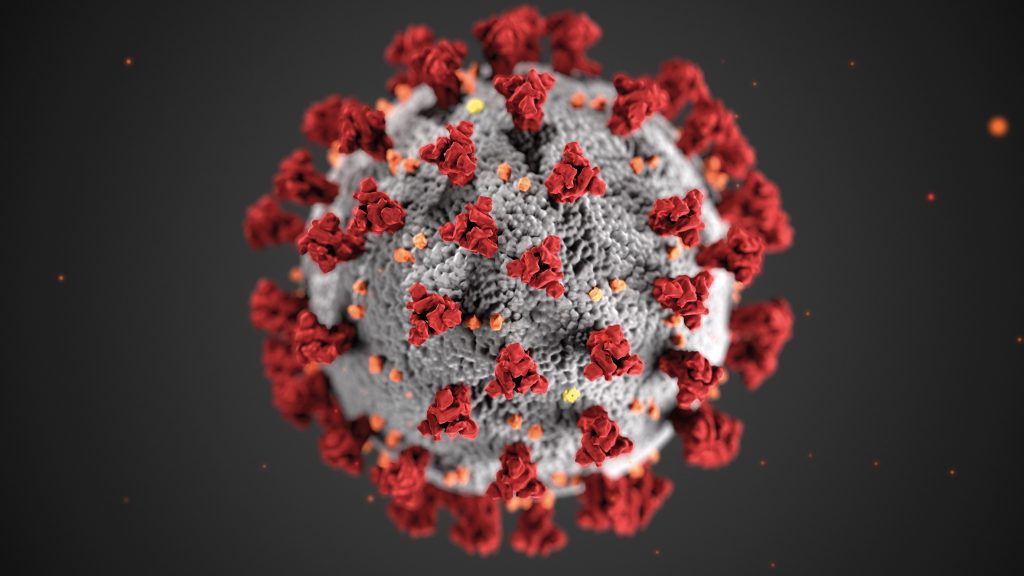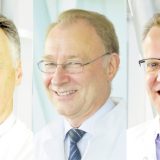Intelligente Hilfe im OP-Saal der Zukunft

Im Gespräch mit der Informatikerin Stefanie Speidel, Professorin für „Translationale Chirurgische Onkologie“am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Dresden
Um den Kampf gegen die Volkskrankheit Krebs zu gewinnen, sind zukunftsweisende Techniken gefragt. Stefanie Speidel forscht seit Jahren an intelligenten Assistenzsystemen für den Operationssaal. Chirurgen, die minimal-invasiv arbeiten, werden damit sicherer und exakter ans Ziel geführt. Besonders Tumoroperationen dürften von den computergestützten Anwendungen profitieren. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entwickelte Stefanie Speidel beispielsweise Navigationssysteme für den optimalen Schnitt bei der Operation sowie eine Software für Datenbrillen, mit deren Hilfe sich der Chirurg schon vor der Operation ein dreidimensionales Modell des zu behandelnden Organs oder Gewebes ansehen kann. Seit 1. April 2017 ist die Informatikerin nun die erste Professorin am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Dresden. Anlässlich der Ernennung sprach das Top Gesundheitsforum mit Stefanie Speidel über ihre Forschung und die Potenziale nach dem Standortwechsel.
Seit wann forschen Sie an intelligenten Assistenzsystemen für den Operationssaal?
Professor Stefanie Speidel: 2005 habe ich für meine Promotion in Zusammenarbeit mit Ärzten des Universitätsklinikums Heidelberg und Wissenschaftlern des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) im Rahmen eines Graduiertenkollegs angefangen, über das Thema intelligente Chirurgie zu forschen. Daraus hat sich eine Nachwuchsgruppe entwickelt, mit der ich nun auch nach Dresden gewechselt bin.
Was ist der konkrete Nutzen der neuen Technologien für den OP-Saal?
Letztendlich geht es darum, die Operationen im Kontext einer innovationsfreudigen Chirurgie 4.0 mit Hilfe computergestützter Methoden zu verbessern. Das Ziel ist, dass die digitalen Informationen des Patienten umfassend zur Verfügung stehen. Während des Eingriffs soll wiederum sichergestellt werden, dass die entscheidenden Informationen zum richtigen Zeitpunkt abrufbar sind. Eine solche Assistenz kann etwa sein, dass die Tumorposition visualisiert wird oder dass Komplikationen vorhergesagt werden. Zudem soll es mit dem Datenmaterial möglich sein, die Operation vorab zu simulieren.

Prof. Stefanie Speidel mit Prof. Dr. med. Jürgen Weitz, MSc, Direktor der Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden, im OP / Foto: Holger Ostermeyer / Uniklinikum Dresden
Welche Daten müssen dafür erhoben werden?
Die Basis sind Patientendaten, die vor der Operation erhoben werden, etwa Bilddaten oder Laborwerte. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt aber in der Analyse von Sensordaten während der Operation. Wir wollen beispielsweise in Echtzeit die optimale Route für den Operateur bestimmen, im Prinzip wie die Navigationsinstrumente eines Autos. Auch die Analyse und Darstellung von Ziel- und Risikostrukturen wie Tumoren oder Gefäße beim Patienten gehört zu den Funktionen, die wir ermöglichen wollen. Aktuell wird das Potenzial der Daten allerdings überhaupt nicht genutzt. Der Chirurg muss sich auf den Patienten konzentrieren und kann der Informationsflut nur schwer Herr werden. Dazu sollen die Assistenzfunktionen dienen. Das kann auch ein Roboter sein, der zum Beispiel das Endoskop automatisch nachführt. Es gibt wirklich eine Fülle an denkbaren Assistenzfunktionen.
Welche Rolle spielen Automatisierungstechniken in dieser Chirurgie der Zukunft?
Man kann sicherlich Teilschritte automatisieren, aber das Ziel ist es nicht, den Chirurgen zu ersetzen. Stattdessen wollen wir ihm Hilfen zur Verfügung stellen, um die Operation zu verbessern und die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt anzuzeigen. Die von uns gewonnenen Daten liefern dem Chirurgen eine objektive Grundlage für Entscheidungen, die er während einer OP treffen muss. Das entlastet ihn deutlich und er kann sich stärker auf seine manuellen Fähigkeiten konzentrieren.
Welche Hürden stehen der aktuellen Forschung und einer mittelfristigen Entwicklung der Assistenzsysteme noch im Weg?
Das größte Problem ist eigentlich, überhaupt an Daten zu kommen. Viele relevante Informationen liegen im Krankenhaus leider gar nicht vor, zumindest nicht in digitaler Form, so dass wir sie auswerten können. Deswegen spielt die Digitalisierung für unsere Arbeit eine sehr wichtige Rolle. Wir brauchen eine Datengrundlage, um unsere Methoden zu entwickeln. Wenn man beispielsweise Komplikationen vorhersagen will, braucht man Daten von möglichst vielen bereits ausgeführten Eingriffen, mit denen man die aktuelle Operation vergleichen kann.
Eine Assistenzfunktion, die sie entwickeln, ist die Software für eine Datenbrille, mit der der Arzt eine dreidimensionale Abbildung der zu behandelnden Organe oder Gewebe sehen kann. In welchem Zusammenhang kommt diese Technik zum Einsatz?
Die Datenbrille greift den Gedanken auf, dass die Operation im Vorfeld simuliert werden kann. Auch hier sind die Grundlagen die digitalen Patienteninformationen. Aus den Bildern wird dann ein 3D-Modell erstellt. Der große Gewinn dieser Technik ist, dass sich der Arzt einen dreidimensionalen Eindruck der betroffenen Organe und der Beschaffenheit der Tumore verschaffen kann. Bei komplexen Fällen, wie einer stark metastasierten Leber, ist es beispielsweise sehr wichtig zu wissen, wie und wo man schneidet, damit ein gewisses Restvolumen der Leber erhalten bleibt. Mit unserem System lässt sich dann ein genauer Schnittplan festlegen. Zudem kann man dieses Operations-Planungssystem natürlich auch optimal zu Ausbildungszwecken nutzen.
Können Sie abschätzen, wann die Systeme anwendbar sind?
Es gibt verschiedene Stufen. Für das Planungssystem haben wir gerade eine Pilotstudie gestartet. Da sind die Hürden relativ gering. Bei Systemen aber, die während der Operation eingesetzt werden, wird noch einige Zeit vergehen, bis diese im klinischen Alltag angekommen sind. Ich schätze mindestens zehn Jahre.
Welche Vorteile sehen Sie für Ihre Forschungsarbeit nach dem Wechsel von Karlsruhe ans NCT Dresden?
Die Infrastruktur in Dresden ist wirklich einmalig. Wir liegen direkt auf dem Klinikums-Campus, haben Zugang zu den Kliniken und damit möglichen Kooperationspartnern. Dank der Informatik- und Ingenieurswissenschaften an der TU Dresden können wir für die technischen Aspekte unserer Forschungsarbeit auf gut geschulten Nachwuchs bauen. Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, von dessen Forschung hinsichtlich intraoperativer Bildgebung wir profitieren. Es ist eher ungewöhnlich, dass sich alle relevanten Institutionen an einem Ort vereinen. Hinzu kommt natürlich das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg, das ebenfalls zu den Trägern des NCT Dresden gehört. Ich freue mich sehr auf den Neubau des NCT-Gebäudes mit dem experimentellen Operationssaal, der allein für die Forschung zur Verfügung gestellt wird.
Interview: Philipp Demankowski