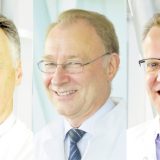Wenn Angst das Leben beherrscht

Gespräch mit Prof. Dr. Kerstin Weidner über die erfolgreiche Behandlung mit Konfrontation als Therapie
Die Hände sind im Nu schweißnass, das Herz rast, die Knie zittern, alles um ihn herum scheint sich zu drehen – er hat Angst. Dabei kommt ihm nur ein Schäferhund entgegen, der am Feldrand schnüffelt, gefolgt von seinem Herrchen. Sobald die „Gefahr“ vorüber ist, sind die Symptome verschwunden. Der Mann weiß, dass seine Reaktion unsinnig ist, aber er kann nichts dagegen tun, außer Begegnungen mit Hunden möglichst aus dem Weg zu gehen. – Wir wissen, dass Ängste zum Leben gehören und hilfreich sein können, um uns vor Gefahren zu schützen. Oft aber sind sie irrational und schränken die Lebensqualität der Betroffenen massiv ein, bis hin zum Jobverlust oder dem Abbrechen sozialer Kontakte. Doch man muss sich mit solchen Panikattacken nicht abfinden. Angststörungen zählen zu den häufigsten und am besten zu behandelnden psychischen Störungen, wie Prof. Dr. med. habil. Kerstin Weidner, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, berichtet.
Ist der Eindruck richtig, dass immer mehr Menschen unter psychischen Störungen leiden und sich deshalb auch in ärztliche Behandlung begeben?
Professor Weidner: Sicher gibt es eine Zunahme an psychischen Störungen, die ihre Ursache hauptsächlich in einer höheren Arbeitsdichte und permanenter Überforderung haben. Aber es gibt auch eine höhere Erkennungsrate. Die Menschen gehen eher zum Arzt als früher, wenn sie sich ihrem Alltag nicht mehr gewachsen fühlen. Noch vor Jahren war das anders. Da wurden psychische Probleme möglichst verschwiegen. Die Wurzeln für Angststörungen finden sich oft in der Kindheit oder im Jugendalter durch biografische Erfahrungen oder hohen Leistungsdruck. Angstkrankheiten sollten unbedingt ernst genommen werden, denn unbehandelt verlaufen sie meist chronisch. Außerdem ist dann die Wahrscheinlichkeit, an einer weiteren psychischen Störung zu erkranken, deutlich erhöht.
Vor Ängsten scheint niemand gefeit zu sein. Wann und bei welchen sollte man eine Therapie in Erwägung ziehen?
Wir unterscheiden Panikstörungen, Generalisierte Angststörungen, Phobien und Zwangsstörungen. Panikattacken sind dadurch gekennzeichnet, dass sie plötzlich und unerwartet auftreten und mit starken körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Atemnot, Benommenheit, Unwirklichkeitsgefühlen bis hin zu Todesangst verbunden sind. Unter sogenannten Agoraphobien versteht man die Angst vor Orten oder Situationen, von denen die Flucht unmöglich oder peinlich erscheint oder im Falle einer Panikattacke keine Hilfe verfügbar wäre. Die Konsequenz für Betroffene ist dann mitunter, dass sie ihr Haus nicht mehr verlassen, keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, letzten Endes ihren Arbeitsplatz verlieren. Auch spezifische Phobien wie z.B. Tierphobien schränken die Betroffenen durch Vermeidungsstrategien ein. Patienten mit körperbezogenen Ängsten wie Hypochondrie verursachen hohe Kosten im Gesundheitssystem. Von generalisierten Angststörungen spricht man, wenn der Mensch in Sorgenkreisläufen gefangen ist, beispielsweise wenn sich eine Mutter immer wieder vorstellt, was alles Schlimmes passieren kann, wenn ihr Kind allein zur Schule geht und letztendlich die Selbständigkeit des Kindes unterdrückt wird. Solch eine erweiterte Vermeidungsstrategie beeinträchtigt auch das Verhalten und Denken des Kindes. Ebenso können Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, wie der Drang Dinge immer wieder zu kontrollieren, den Alltag massiv beeinträchtigen. Ärztliche Hilfe sollte man suchen, wenn die Beeinträchtigungen durch die Angststörung – egal, um welche es sich handelt – die Leistungsfähigkeit deutlich herabsetzen und ein normales Leben erschweren.
Fakt ist, dass Termine bei Psychotherapeuten zeitnah schwer zu erhalten sind. Was muss der Patient tun, um einen Platz in der Angst-Ambulanz bzw. -Tagesklinik zu bekommen?
Erste Anlaufstelle sollte sein Hausarzt sein. Möglich, dass er den Patienten arbeitsunfähig schreibt und ihm ein Beruhigungsmedikament verordnet. Das mag als „erste Hilfe“ nachvollziehbar sein, langfristig trägt es jedoch zur Chronifizierung bei, ist also schädigend. In der Regel erfolgt eine Überweisung zum Facharzt, Psychotherapeuten oder in die Angst-Ambulanz. Hier findet eine umfangreiche Diagnostik statt. Aufgrund dieser werden Behandlungskonzepte vorgeschlagen und entschieden, ob eine ambulante Therapie möglich ist. Sollte der Patient eine solche Behandlung vielleicht schon einmal absolviert haben ohne den gewünschten Erfolg, oder sollten derartige Angebote nicht zur Verfügung stehen, kommt eine tagesklinische Aufnahme in Betracht. Allerdings geht das auch nicht von heute auf morgen, wir haben dafür Wartelisten, begleiten aber die Patienten auf der Warteliste in einer wöchentlichen ambulanten Vorbereitungsgruppe.
Welche Therapien werden in der Angst-Tagesklinik angewandt?
Nach dieser ambulanten Vorbereitungstherapie, bei der sich die Patienten unter anderem in der Gruppe über ihre Erfahrungen mit Ängsten austauschen, beginnt das auf fünf Wochen angelegte sogenannte Angst-Modul in einem multiprofessionellen Team. An fünf Tagen in der Woche sind die Patienten von morgens bis nachmittags in der Klinik. Jeweils acht Patienten beginnen gleichzeitig ihre Behandlung. Schwerpunkt der Behandlungen ist eine konsequente Expositionstherapie. Sie bedeutet, dass der Patient in Begleitung eines Therapeuten in die Angst auslösende Situation gebracht wird, um neue Erfahrungen in den Angstsituationen zu machen und ungünstige Teufelskreise der Angst zu durchbrechen. Ein Beispiel: Jemand gerät in Panik, sobald er sein Haus verlassen soll. Anfangs wird er ein Taxi nehmen müssen, um in die Tagesklinik zu kommen. Dann wird der Therapeut mit ihm gezielt Strategien entwickeln, im Einzelfall ihn auch abholen und in die Exposition begleiten. Oder aber der Berufskraftfahrer, der sich nach einem schweren Unfall nicht mehr hinters Steuer traut. Auch hier wird der Psychotherapeut nach entsprechender Vorbereitung ihn allmählich dazu befähigen, mit seiner Angst umzugehen, sich wieder hinters Lenkrad zu setzen und so seinen Job zu behalten. Diese Art der Therapie ist sehr zeit- und personalaufwendig, wie man sich vorstellen kann. Darüber hinaus wird in kognitiv-verhaltenstherapeutischen Einzel- und Gruppensitzungen unter anderem darüber gesprochen, welche Ursachen zu Ängsten führen können, und welche Problemlösungen es gibt. Stressbewältigung und Stressprophylaxe, Körper- und Kunsttherapie sind weitere Inhalte der tagesklinischen Behandlung.
Was geschieht mit dem Patienten, wenn die fünf Wochen Klinikaufenthalt vorbei sind?
Das hängt davon ab, in welchem Maße er noch weitere Hilfe benötigt. In der Regel wird die Nachsorge ambulant durchgeführt. Dr. René Noack, Leiter der Angst-Tagesklinik, und das Therapeutenteam haben dafür ein Netz ambulant tätiger Kollegen geknüpft. Im Rahmen solch einer Nachsorgegruppe oder aber in Einzelsitzungen sollen die Therapieerfolge gefestigt werden. Unter Umständen werden auch weitere, tiefergehende Therapien notwendig. Außerdem gehören sogenannte „Boosterwochen“ zum Therapiekonzept. In dreiwöchigen teilstationären Programmen werden nach sechs bis zwölf Monaten die Erkenntnisse aus der Therapie noch einmal gefestigt. Fazit: Kein Patient wird mit seinen Problemen alleingelassen. Das Vorgehen ist immer sehr individuell. Ziel soll sein, dem Betroffenen einen beruflichen Wiedereinstieg zu ermöglichen.
Sind Angststörungen auch ein Thema Ihrer Forschungen?
Durchaus. Zum Beispiel untersuchen besonders Dr. Noack und seine Mitarbeiter, welche Patienten mehr und welche weniger von den Therapien profitieren, und was die Ursachen dafür sind. Auch deshalb finden nach drei Monaten und einem Jahr nochmals Befragungen statt. Nicht immer ist ein Ausbleiben der Symptome in den bewussten Situationen gleichbedeutend mit der vollständigen Überwindung der Angststörung. Es kann auch ein Symptomwechsel stattfinden und nach einiger Zeit eine andere psychische Störung auftreten. Warum das so ist, muss in einem engen Vertrauensverhältnis von Patient und Therapeut ergründet werden. Und natürlich beschäftigen diese Fragen auch die Forschung. Was die wissenschaftliche Arbeit betrifft, stehen wir im Austausch mit den Unikliniken in Bonn und Mainz, die sich so wie wir intensiv mit Ängsten befassen. Übrigens werden wir bei der diesjährigen Jahrestagung unserer Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik am 23. und 24. September mit Gästen aus ganz Deutschland die Thematik Zwangsstörungen behandeln.
Interview: Regine Hauswald-Tezky