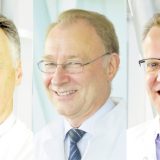Trauma – erkennen, verstehen, behandeln und heilen
Text: Karl-Heinz Knebel
Viele Menschen leiden jahrelang an einem Trauma. Aber sie wissen nicht, weshalb. Das Leiden verkleidet sich als Depression oder Burn-out, als Angststörung oder chronische Verspannung. Oder als inneres Gefühl von Abgeschnittenheit, Nicht-richtig-sein, von Unzufriedenheit, Sinnlosigkeit, Einsamkeit. Was ist der Grund und wie kann geholfen werden?
Die Erfahrung zeigt es immer wieder aufs Neue: Ursache für ein Trauma ist oft ein Geschehen oder Erleben in der Biografie eines Menschen, das weit zurückliegen mag und eine, durch seine Intensität, bleibende psychische, seelische oder mentale Wunde hinterlässt. Aber was ist ein Trauma überhaupt? Im Lehrbuch für Psychotrauma-tologie wird Trauma definiert als „(…) ein vitales Diskrepanz Erlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.“ Trauma (griech. „Wunde“) bezeichnet in der Psychologie also eine seelische Verletzung.
Bei jeder klassischen Definition wird betont, dass eine Gefahr für Leib und Leben bestanden haben muss, zum Beispiel erhebliche psychische, körperliche und sexuelle Gewalt sowie schwere Verlust- und Vernachlässigungserfahrungen. Ein Trauma kann aber auch durch Operationen und Narkosen, Stürze, Trennungen, Verlust naher Angehöriger, Schwangerschaftsabbrüche, Mobbing, Demütigungen, das Bezeugen von Gewalt oder durch Unfälle hervorgerufen werden. Das Problem besteht darin, dass man nicht sagen kann, was für eine -bestimmte Person traumatisch ist, weil Menschen sehr unterschiedliche Schwellen haben, ab denen Stress zum Trauma wird. Peter Levine, ein bekannter Trauma-Psychotherapeut sagt, Trauma entstehe im Nervensystem und nicht im Ereignis. So gesehen entsteht ein Trauma dann, wenn ein Ereignis zu plötzlich, zu schnell, zu massiv oder auch zu anhaltend für einen Menschen geschieht, so dass seine Bewältigungsmechanismen überfordert sind.
Traumata, die aus einem einmaligen Erlebnis resultieren, nennt man Schocktrauma. Mindestens genauso häufig sind sogenannte Entwicklungs- oder Bindungstraumata. Diese ziehen sich über einen langen Zeitraum hin und beeinflussen unsere gesamte Persönlichkeit, unser Lebensgefühl, unsere Überzeugungen und unsere Grundhaltung der Welt gegenüber. Sie wirken sich auf unser Bindungs- und Beziehungsverhalten, unsere Resilienz (Stressresistenz) und unsere Glücksfähigkeit, aus.
Der für die WHO gültige „ICD-10- Klassifikation psychischer Störungen“ gibt drei Traumatisierungsgrade an:
1. Die akute Belastungsreaktion:
Eine vorübergehende Störung, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten Menschen als Reaktion auf eine außergewöhnliche physische oder psychische Belastung entwickelt und die im Allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt. Dazu gehören Angst, Desorientierung, Ärger oder verbale Aggression, Verzweiflung, Überaktivität und unkontrollierbare Trauer.
2. Anpassungsstörungen:
Hierbei handelt es sich um Zustände von subjektiver Bedrängnis und emotionaler Beeinträchtigung, die im Allgemeinen soziale Funktionen und Leistungen behindern und während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensveränderung oder nach belastenden Lebensereignissen auftreten. Symptome sind unter anderem Ängste, Depressionen, Trauer, psychosomatische Störungen, sozialer Rückzug. Sie beginnen innerhalb eines Monats und werden für die Dauer von sechs Monaten als Kriterium einer Anpassungsstörung erfasst.
3. Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS):
Hier handelt es sich um Schock-, Entwicklungs- oder Bindungstraumata und den daraus folgenden Symptomen. Dazu gehören Flashbacks: Spontan auftretendes Wiedererinnern des/der traumatischen Ereignisse(s), einhergehend mit einem Gefühl, als würde es in diesem Moment geschehen. Vermeidungsverhalten: Orte und Situationen, die an das Trauma erinnern, werden gemieden. Erinnerungslücken: Einzelne Aspekte oder das gesamte traumatische Ereignis sind nicht erinnerbar. Oft auch die Zeit davor und danach, manchmal Jahre. Entfremdungsgefühle: Betroffene haben das Gefühl, nicht richtig da zu sein. Hyperarousal: Ein erhöhtes Erregungsniveau, das sich in Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit, Nervosität und dem Gefühl „ständig auf der Hut“ sein zu müssen zeigt. Dissoziation: Das Abspalten von Persönlichkeitsanteilen bis hin zu einer temporären Bewusstlosigkeit. Ängste: Sie können eine Intensität entwickeln, bis hin zur Vernichtungsangst. Die Symptome treten im Allgemeinen innerhalb eines halben Jahres auf und können, ohne Hilfe, Jahre andauern.
Wie entsteht ein Trauma?
Um die Folgen von Traumata zu verstehen, muss man begreifen, wie der Mensch auf Gefahr reagiert. Diese Reaktionen sind tief im biologischen Erbe verankert und sind weder pathologisch noch unnormal. Sie sind Teil unserer Instinkte, die im Falle einer Gefahr das Steuer übernehmen und unser unbeschadetes Überleben sichern sollen. Zu diesen Instinkten des Überlebens gehören die Begriffe Flucht, Kampf und Erstarrung. In einer Gefahrensituation, in der es ums Überleben geht, schaltet der Mensch auf Angriff, um die Gefahr zu besiegen oder er geht in den Fluchtmodus, um sich der Gefahr zu entziehen. Erkennt er, dass beides aussichtslos ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jetzt eine Erstarrungsreaktion eintritt. Der Mensch stellt sich tot. Die biologische Erstarrungsreaktion erhöht für das angegriffene Lebewesen potenziell die Wahrscheinlichkeit, zu überleben. Es macht sich in gewisser Weise unsichtbar. Für den heutigen Menschen hat diese Reaktion schwerwiegende Folgen. Meist ist sie gekoppelt mit einer sogenannten Dissoziation. In traumatischen Situationen beschreiben viele Betroffene, dass sich ihr Geist vom Körper abkoppelt, sie empfinden keinen Schmerz oder keine Angst und haben nicht das Gefühl, dass ihnen das gerade selbst widerfährt. Heute weiß man, dass diese Dissoziationserfahrung zu den stärksten Indikatoren für später einsetzende posttraumatische Symptome gilt.
Bei einem Schocktrauma, also einem einmaligen Erlebnis, werden die Bewältigungsmechanismen überfordert. Es kommt zu einer Erstarrung. Man kann zwei Formen der Erstarrung unterscheiden. Zunächst eine angespannte Erstarrung, in der enorm viel Energie gehalten wird, sie ist immer noch hochgradig sympathikoton, also vom sympathischen Zweig des Nervensystems gesteuert. Hält die Situation jedoch an, verlässt plötzlich jede Spannung den Körper, man kollabiert, dies wird vom parasympathischen Nervensystem gesteuert. Je jünger der Mensch zum Zeitpunkt des Ereignisses war und je hilfloser er sich dabei gefühlt hat, desto wahrscheinlicher wird diese zweite Reaktion in Kraft treten. Es ist wichtig, den Unterschied zu erkennen.
Bei der ersten Form der Erstarrung ist noch Kraft vorhanden, um sich zu verteidigen. Bei der zweiten Form verlässt den Menschen jede Spannung, er wird gewissermaßen betäubt. Bei einem Entwicklungstrauma hat sich dieses „Toleranzfenster“ von Kampf – Flucht – Erstarrung erst gar nicht ausreichend entwickelt und wird deshalb beinahe chronisch überschritten. Eine Traumatisierung tritt dann ein, wenn der Körper keine Meldung bekommt, dass das Ereignis vorüber ist und eine Normalisierung stattfinden kann. Dies ist meist dann der Fall, wenn Menschen so überwältigt waren, dass das parasympathische Notsystem zum Einsatz kam. Das Nervensystem hat dann keine Chance, sich wieder zu normalisieren und zu regulieren. Es schwankt von einem Zustand der Übererregung zu einem Zustand der Untererregung. Der zeitliche Abstand ist dabei unterschiedlich. Bei manchen Menschen normalisiert sich dieser Zustand nach spätestens sechs Monaten wieder, bei anderen bleibt dieser Zustand für den Rest ihres Lebens erhalten.
Ein Mensch, der davon ausgeht, dass immerwährend Gefahr droht und die Welt ein gefährlicher Ort ist, wird sich anders durch sein Leben bewegen und auf Menschen zugehen als jemand, der davon ausgeht, dass Menschen erst einmal freundlich gesonnen sind und die Welt es gut mit ihm meint. Dies ist sicherlich eine der gravierendsten Veränderungen, die mit traumatischen Ereignissen in Zusammenhang stehen. Am stärksten ist dies bei Menschen mit sehr frühen Traumatisierungen der Fall, bei denen diese innere Wahrnehmung von Gefahr in die „Persönlichkeits-DNA“ eingraviert ist.
Eine weitere Auswirkung einer Traumatisierung ist der Verlust der Verbundenheit mit dem eigenen Körper. Die innere Wahrnehmung des Körpers ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was für ein zufriedenes und erfülltes Leben gebraucht wird. Bei allzu großen Schmerzen wird der Körper gerne verlassen. Diese Abspaltung oder Dissoziation kann zu einem bleibenden Zustand werden, den die meisten Menschen in ihrem Alltag kaum wahrnehmen, da sie immer noch in der Lage sind, diesen zu meistern. Der Preis der Abspaltung des Körpers ist auch eine Verflachung aller Gefühle.
Dies ist einerseits sinnvoll, da alte Schmerzen auf diese Weise eingekapselt werden und nicht mehr wehtun. Andererseits werden positive Gefühle auch nicht mehr in ihrer Fülle erlebt. Angstzustände und Panikattacken zählen viele Trauma-Therapeuten zu den Symptomen von Traumata. Auch tiefe Sinnlosigkeit und ein Zustand des Abgeschnitten-Sein von anderen Menschen bis hin zu einem „ich bin nicht richtig, mit mir stimmt was nicht“ sind durchaus Hinweise auf ein frühes Trauma, dass sich der Erinnerung entzieht.

Psychotherapien zur Behandlung und Heilung
Um sich einem Trauma und seinen Folgen zu stellen, bedarf es Mut. Es gibt jedoch Möglichkeiten, Symptome einer Traumatisierung zu lindern oder sogar zu heilen. Die bekannteste Methode ist sicher EMDR, das bedeutet „Eye Movement Desensitization and Reprocessing“. Hierbei wird das Gehirn bilateral stimuliert, das heißt abwechselnd rechts und links durch Klopfen auf den rechten und linken Oberschenkel oder indem man mit den Augen dem Finger des Therapeuten oder der Therapeutin von rechts nach links folgt, während man sich im traumatischen Erleben befindet. Vorher klassifiziert man das traumatische Ereignis und seine Belastung auf einer Skala von 0 bis 10. Dies wiederholt man nach jedem Durchgang und macht es so lange, bis der traumatische Inhalt nicht mehr überwältigend ist. Man geht davon aus, dass durch bilaterale Stimulation dem Gehirn geholfen wird, ein Ereignis schneller zu verarbeiten. Eine weitere Möglichkeit ist die Verhaltenstherapie mit der Bildschirmmethode. Sie ist sehr verbreitet, da sie von den Krankenkassen anerkannt ist.
Sehr zu empfehlen sind die körperorientierten Traumatherapien. Hier ist die bekannteste die Somatic Experiencing (SE) von Peter Levine, die ressourcenfokussierte Ego-State-Therapy, oder auch die von der Psychotherapeutin Dami Charf entwickelte Somatische Emotionale Integration (SEI). Bei diesen Methoden wird man dem traumatischen Ereignis emotional nicht mehr aus-gesetzt. Bei den körperorientierten Methoden geht es darum, die im Körper und Nervensystem festgehaltene Energie und die erstarrten Reflexe zu lösen und sie wieder zur freien Verfügung zu haben. Die Voraussetzung dafür ist, mit dem Klienten oder der Klientin zusammen wieder ein zugewandtes und wohlwollendes Gefühl für den eigenen Körper zu erarbeiten. Im Körper drücken sich auch Gefühle aus, die ungern gezeigt werden oder so alt sind, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden. Das Wichtigste aber in der Trauma-Psychotherapie bleibt der oder die Therapeut/in. Hier bedarf es großer Sorgfalt bei der Auswahl, denn die Psychotherapieforschung hat ergeben, dass nicht die Methode heilt, sondern die Beziehungsfähigkeit der Therapeuten.