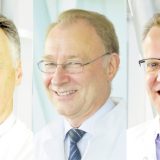Langfristig erfolgreich bleiben: New Work und eine gute Bilanz
Berichte und Studien über die Krankenversorgung in Deutschland und Europa stimmen wenig euphorisch. Sie beschreiben nahezu unisono eine Situation der Krankenhäuser, die nie dramatischer war. Während sich der Konsolidierungsprozess im Krankenhaussektor 2019 und 2020 weiter fortsetzte, haben die Jahre 2021 und 2022 eine rasante Talfahrt mit sich gebracht – Tendenzen, die sich vorher andeuteten, zeigen sich seitdem weit deutlicher und führen zu einem wirtschaftlichen Desaster. Erste Kliniken melden Insolvenz an und weitere, vor allem im ländlichen Raum, werden folgen. Nahezu ebenfalls gleichlautend sind die Begründungen für die schlechte Situation: auslaufende Ausgleichszahlungen und steigender Personalmangel bei bestehender Fachkräftekrise. Wie geht das Universitätsklinikum Dresden damit um? Top Gesundheitsforum hat mit dem Kaufmännischen Vorstand Frank Ohi über Herausforderungen, Lösungen und Chancen gesprochen.
Herr Ohi, das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden ist als Haus der Supra-Maximalversorgung einer der größte Arbeitgeber der Region. Im Sommer 2023 wurde der Jahresabschluss des vorausgehenden Geschäftsjahres veröffentlicht – mit einem deutlich besseren Ergebnis als im Jahr davor, dennoch aber mit einem Minus davor. Was heißt das konkret?
Frank Ohi: Trotz gestiegener Personalkosten und zusätzlich eingestellter Mitarbeitenden konnten wir 2022 ein deutlich besseres Ergebnis erzielen, zugleich aber die Leistung konstant halten. Wir liegen bei einem Gesamtergebnis von -2,7 Millionen Euro und dürften damit innerhalb der bundesweiten Krankenhauslandschaft ein gutes Ergebnis ausweisen. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 belief sich das Ergebnis auf -10 Millionen Euro. Um diese Verbesserung zu erreichen, war es einerseits nötig, Kosten zu senken, etwa beim Einkauf von Medikalprodukten oder bei bestimmten Dienstleistungen. Außerdem haben wir hart mit den Kassen verhandelt, um Ausgleichszahlungen in bestimmten Bereichen zu erhalten und neue Vergütungsmodelle zu implementieren. Sondereffekte wie Coronahilfen konnten die entstandenen Defizite allerdings nicht so ausgleichen, wie es nötig gewesen wäre – diesen Ausgleichszahlungen standen gestiegene Energiekosten für unser Haus von etwa 15 Millionen Euro gegenüber. Das Ergebnis unterm Strich zeigt, dass wir mit all unseren Mitarbeitern insbesondere im Vergleich mit anderen Universitätsklinika einen offenbar sehr guten Job gemacht haben. Konkret heißt das, dass wir weitere Investitionen in Personal und Infrastruktur vornehmen können. Mit Blick auf die Gesamtinvestitionen ist das Ergebnis bemerkenswert, da wir neben Bundes- und Landesmitteln einen erheblichen Anteil an Eigenmitteln investieren. Insofern kann man von einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit sowohl mit dem Freistaat als auch dem Bund sprechen, wofür wir enorm dankbar sind.
Aber auch Sie stehen doch vor einem Berg an Herausforderungen? Was heißt das für ein Haus Ihrer Größenordnung?
Wir werden uns mittel- und langfristig massiven strukturellen Veränderungen stellen müssen. Beispielhaft seien hier anstehende Investitionen in die Gebäudesanierungen genannt, genauso wie unser Arbeiten an krisenfesten IT-Infrastrukturen – immer unter dem Vorzeichen der steigenden Kosten.
Was bedeutet denn die unsichere Finanzlage, bspw. auf dem Energiemarkt, für Sie?
Sie ist unkalkulierbar, das kann man schon so klar sagen. Aber wir sind uns mit unserem Medizinischen Vorstand, Prof. Michael Albrecht, einig. Die Situation darf keinen Stillstand bedingen. Das Uniklinikum hält an der Strategie fest, weiterhin zu investieren. Gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät – die in diesem Jahr auch ein solides Ergebnis ausweisen kann – werden wir uns weiterentwickeln. Wir werden weiter bauen und strategisch investieren, unter anderem in die Altersmedizin, in die Labordiagnostik und in die Metabolomforschung. Allein in den Bau des Zentrums für Seelische Gesundheit fließt ein dreistelliger Millionenbetrag, der zeitlich trotz der zusätzlichen finanziellen Belastung nahtlos weitergeführt wird. Die Eröffnung ist für 2025 geplant.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, worauf müssen wir uns einstellen und was sind Ihre Entwicklungsfelder in den kommenden Jahren?
In Anbetracht der noch unklaren Umsetzung der Krankenhausstrukturreform ist eine Vorausschau tatsächlich schwierig. Im Idealfall jedoch werden Effizienzsteigerungen und Leistungsverteilungen zu einem Upgrade der Versorgungssituation führen. Zumindest würde ich mir das wünschen. Letztlich haben wir schon sehr viele scheinbar unüberwindbare Hürden seit der Einführung der DRG-Fallpauschalen und Zusatzentgelte im Jahr 2004 genommen. Wir werden auch dieses Mal Lösungen finden. Dabei kommt den richtigen Partnern inner- und außerhalb der Krankenhäuser eine entscheidende Rolle zu. Mit dem Freistaat haben wir einen Eigner, der uns hierfür Rückendeckung gibt.
Geht es den anderen Häusern der Region ebenso?
Überleben werden jene Häuser, die bereit sind, zu kooperieren und Synergien zu heben. Dabei gilt es auch, für die Region mitzudenken. Ein Zusammenbruch des Krankenhausnetzes in der Region Ostsachsen wäre nicht nur für die Menschen im ländlichen Raum fatal. Er wäre auch mit weiteren Verbindlichkeiten für das Uniklinikum verbunden, die nur bedingt bedient werden könnten. Wir wollen unseren Anteil leisten, indem wir durch wirtschaftlich sinnvolle Kooperationsprojekte gegensteuern. Hier wünschen wir eine auskömmliche Finanzierung – gerade in den Anfangsjahren.
Die Krankenhausstrukturreform sagt doch genau das aus, oder?
Ja, und wir leben das in der Dresdner Hochschulmedizin schon seit Jahren. Es ist für uns keine „neue Art der Gesundheitsversorgung“, sondern eine logische Zukunftsaufgabe. Krankenhäuser und Kliniken fokussieren sich auf jene Bereiche, in denen besonders große Expertise vorhanden ist. Darüber hinaus fokussieren wir uns häuserübergreifend auf eine Bündelung medizinischer Dienstleistungen. Wir möchten Ausbildungskonzepte etablieren und den ambulanten Sektor stärken. Leistungen könnten dann gezielter verteilt und damit die wirtschaftliche Daseinsberechtigung aller Krankenhäuser gesichert werden.
Welche Kriterien sollten aus Ihrer Sicht darüber entscheiden, welche Leistungen welches Krankenhaus vorhalten muss?
Eindeutig die Leistungszahlen und damit die Qualität. Es macht keinen Sinn, wenn kleinere Häuser durch Erlösanreize komplexe Operationen anbieten, ohne durch Fallzahlen belegen zu können, dass die Expertise dafür vorhanden ist. Andersherum macht es keinen Sinn, dass komplex aufgestellte Zentren Ressourcen für elektiv planbare Standardeingriffe en masse vorhalten.
Berichte über wegfallende Leistungen und Klinikschließungen hören sich nach einer Apokalypse an. Wie nah ist diese tatsächlich?
Es wäre Schönmalerei, wenn ich sagen würde, dass es der Gesundheits- und vor allem der Krankenhausbranche blendend geht. Wir sehen in der Region, dass das nicht so ist. Statt in die Klagelieder einzustimmen, sollten wir allerdings Lösungen finden. Dazu gehören Kooperationen und vor allem Konzepte gegen den Fachkräftemangel. Wir werden keine Leute aus dem Boden stampfen können, vielmehr sollten wir aber unsere Leistungen bündeln und so sinnvolle Synergien heben.
Was konkret tun Sie denn gegen den Fachkräftemangel, der ja auch Sie umtreiben dürfte?
Natürlich tut er das. Wir sind aber eines der wenigen Häuser, die sehr früh begonnen haben, Modelle zu etablieren, die klar auf die Gesundheit und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden abzielen. Es ist letztlich eine Tatsache, dass wir durch teilweisen Mangel an Personal in sowieso schon hoch frequentierten Bereichen unseres Hauses, insbesondere im medizinischen und pflegerischen Bereich, eine deutliche Arbeitsverdichtung verzeichnen. Dabei gilt es nicht nur Stresssituationen und Zeiten großer Belastung auszugleichen, sondern auch mittel- und langfristig vorzubeugen.
Wie sieht denn das Patentrezept am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden aus?
Ein Patentrezept haben auch wir nicht. Aber wir üben uns im sorgsamen Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben nicht nur Konzepte zur Personalentwicklung etabliert, sondern arbeiten an einem echten Paradigmenwechsel. Dabei geht es uns nicht darum, die jüngeren Mitarbeitenden massiv zu bevorzugen. Vielmehr arbeiten wir auch daran, die Ressource der älteren Belegschaft wertzuschätzen. Sie sind unser Wissens- und Wertespeicher, das Fundament unseres Hauses. Und wir müssen weg von einer reinen Berufsgruppenorientierung, hin zu einer übergreifend verzahnten Wissenskultur mit unvoreingenommenem Respekt voreinander. Professionelles Personalmanagement findet nicht in Silos statt, sondern muss prozessualen Anforderungen des Klinikbetriebes genügen. Das alles antizipieren wir, arbeiten wir auf und machen als Ergebnis sehr konkrete Angebote an unsere Mitarbeitenden.
Wir sehen einen deutlich gestiegenen Wunsch nach mehr Flexibilität. Das fängt mit einer Erleichterung des Alltags an und hört mit Konten auf, auf denen man sich individuell Zeit ansparen kann. Denn so lapidar es auch klingen mag – wir haben eine Verantwortung, die nicht beim Renteneintritt endet. Und auch der sollte möglichst nicht bis zur Schmerzgrenze gezogen werden. Hier spielen Lebenszeitkonten eine Rolle, die zum Beispiel einen früheren Austritt oder individuelle Arbeitsmodelle möglich machen.
Interview: Philipp Demankowski