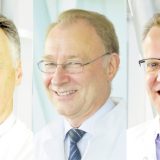Mit Lichtstrahlen gezielter im Gehirn operieren

Während der Operation in sensiblen Gehirnbereichen liefern Lichtstrahlen Professorin Gabriele Schackert ein genaues Abbild davon, wo bei dem Patienten Seh- und Gefühlszentrum sowie das kranke Gewebe liegen. Mit dieser am Uniklinikum Dresden entwickelten Technologie kann gezielter und schonender operiert werden. Derzeit soll eine klinische Studie zeigen, ob diese neuartige Bildgebung bei Gehirnoperationen auch in anderen Krankenhäusern funktioniert. Das verbesserte Bildverfahren in der Neurochirurgie könnte auch für andere chirurgische Fächer eine Schrittmacherfunktion haben.
Das Gehirn ist in der Tat eine komplexe Struktur: Um die 100 Milliarden Nervenzellen sind im Gehirn miteinander verknüpft. Sie sorgen dafür, dass wir Menschen denken, sprechen, fühlen, sehen und uns bewegen können. Sie machen uns zur Persönlichkeit. Bei Operationen im Gehirn muss somit jeder Handgriff millimetergenau sitzen, eine klitzekleine falsche Bewegung kann fatale Folgen für die Lebensqualität der Patienten nach der OP haben. „Um Gehirntumore vollständig zu entfernen, müssen wir Hirnchirurgen auch noch einen kleinen Teil des benachbarten gesunden Gewebes mit entfernen, damit die Zellnester erfasst werden, die sich dort eingelagert haben. Andererseits dürfen wir von dem Gewebe, das für eine gesunde Hirnfunktion wichtig ist, nur so wenig wie möglich entfernen“, beschreibt Professorin Gabriele Schackert, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus, das Spannungsfeld. Mit Farbstoffen, der Computertomografie oder Ultraschall kann das Gewebe der Hirntumore gut sichtbar gemacht werden. Besonders sensible Bereiche des Gehirns lassen sich mit der Magnetresonanztomografie lokalisieren – allerdings nur vor dem Eingriff. Und nicht immer stimmen die Ergebnisse dieser Untersuchung mit der Realität überein, weiß die Klinikdirektorin: „Wir können dem gesunden Gewebe leider nicht ansehen, für welche Funktion es zuständig ist.“

Prof. Dr. med. Gabriele Schackert, Direktorin der Klinik und Poliklinik
für Neurochirurgie des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus / Foto: ukd gb a5 mz albrecht (dgph)
„Intraoperatives Optical Imaging“, kurz IOI, heißt eine neuartige Methode, mit deren Hilfe erstmals während einer Operation innerhalb von zehn bis fünfzehn Minuten eine zweidimensionale Karte des Gehirns entsteht, auf der man eindeutig das gesunde Gewebe von Tumoren unterscheiden kann. Vor zwei Jahren wurde diese Technologie in Dresden vorgestellt, die ein Team um Professorin Schackert gemeinsam mit der Arbeitsgruppe „Medizinische Bildverarbeitung für die Neurochirurgie“ der TU Dresden unter der Leitung von Frau PD Dr. Morgenstern entwickelt hat. Auch funktionell wichtige Areale wie etwa das Sehfeld oder die Sprachregion können damit mittlerweile identifiziert werden. Die neu entwickelte Lichttechnologie IOI macht sich zunutze, dass aktive Gehirnareale stärker durchblutet sind als andere. Vermehrte Hirnaktivität verändert die Lichtabsorption, wenn die Gehirnoberfläche mit einem Laserlicht bestrahlt wird. Das Ärzteteam um Gabriele Schackert und Oberarzt PD Dr. Stephan Sobottka stimuliert dafür während der Operation Hirnareale. „Wir regen einen Nerv direkt an der Körperoberfläche des narkotisierten Patienten an“, berichtet Professorin Schackert. „Beispielsweise reizen wir den Medianus-Nerv mit Stromimpulsen, erzeugen quasi einen leichten Schmerzreiz. Dieser Nerv liegt an der Innenseite des Unterarms und ist für das Gefühl in der Hand zuständig.“ Als elektrische Impulse werden die Reize von den Nervenzellen an das Gehirn weitergeleitet, wo sie das Gefühlsareal aktivieren und damit stärker durchbluten. Oder die Dresdner Wissenschaftler können auch die Sehrinde im Hinterhaupt aktivieren, in dem sie in die Augen der Patienten leuchten.
Eine Kamera, integriert im Operationsmikroskop, filmt die lichtbestrahlte Hirnoberfläche während der stimulierten Gehirnaktivitäten bei der Operation. Ein Filter vor der Kamera lässt die Wellenlängen durch, in denen das Blut eine starke Lichtabsorption zeigt. Am Computer werden die Informationen über die unterschiedliche Lichtstreuung im Gewebe innerhalb weniger Minuten zu Bildern zusammengesetzt. Es entsteht eine zweidimensionale Karte, in der die aktivierten Hirnareale eindeutig markiert zu erkennen sind.
So können die Dresdner Neurochirurgen während der Operation nahezu in Echtzeit erstmals wichtige Hirnfunktionen auf einem Bildschirm farbig erkennen. Die Bilder sind sehr viel genauer als die bisher vor der OP gemachten Darstellungen einer Magnetresonanztomographie. Mehr als 100 Patienten sind in der Dresdner Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie mittlerweile mit Unterstützung des „Intraoperativen Optical Imaging“ operiert worden. Das IOI wird immer dann eingesetzt, wenn Hirntumore oder auch Gefäßmissbildungen im Gewebe, so genannte Kavernome, in der Nähe von wichtigen Gehirnarealen lokalisiert sind.
„Unsere bisherigen Arbeiten haben die Zuverlässigkeit der Methode nachgewiesen. Wir konnten außerdem die Technologie in den vergangenen zwei Jahren so vereinfachen, dass sie weder zeitaufwendig noch sehr teuer ist“, berichtet Professorin Schackert. „Um die Lebensqualität der Patienten zu bewahren, ist es wichtig, so schonend wie möglich zu operieren.“ In der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Dresden werden jährlich rund 2.300 Operationen durchgeführt, davon mehr als 600, bei denen Hirntumore entfernt werden.
Der technische Fortschritt verbessert die chirurgischen Therapien entscheidend und verschiebt die Grenzen des Machbaren. Die Patienten profitieren von innovativen Entwicklungen, die Behandlungen von Erkrankungen ermöglichen, die früher inoperabel waren. „Medizin muss bezahlbar bleiben“, fordert Gabriele Schackert, die 2015/2016 auch Präsidentin der „Deutschen Gesellschaft für Chirurgie“ war. „Der zunehmende finanzielle Druck zwingt zu Verkürzungen der Liegezeiten, auch bei schwierigsten Eingriffen. Minimalinvasive und interventionelle Maßnahmen ersetzen aufwendige Operationsverfahren.“
Derzeit wird in einer weiteren klinischen Studie geprüft, ob an den Universitätskliniken in Dresden und Leipzig sowie dem amerikanischen „Barrow Neurological Institute“ in Phoenix, einem der größten neurochirurgischen Zentren in den USA, dieselben positiven Ergebnisse wie am Dresdner Universitätsklinikum erzielt werden können. Die Dresdner Wissenschaftler müssen nachweisen, dass sich ihre Methode als zusätzliche Sicherheit während einer Gehirnoperation auch von anderen Neurochirurgen reproduzieren lässt. Erst dann kann beantragt werden, das „Intraoperative Optical Imaging“ als standardisierte Bildgebungstechnologie einzuführen. Bis dahin ist es jedoch ein weiter Weg.
Text: Birte Urban-Eicheler