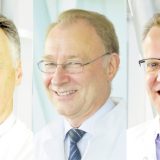Die Hochschulmedizin als Hort für Innovationen
Möglichkeiten einer modernen Medizin, von Robotik und KI: Interview mit Prof. Jürgen Weitz, Direktor der Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie am Uniklinikum Dresden und einer der geschäftsführenden Direktoren am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC)
Welche Vorteile ergeben sich für Ihre Arbeit an einer Klinik der Hochschulmedizin im Vergleich zu anderen Krankenhäusern?
Prof. Jürgen Weitz: Universitätsklinika sind auch für die Versorgung von besonders schwer und komplex erkrankten Patientinnen und Patienten verantwortlich. Damit ist an diesen Häusern auch ein enormer Erfahrungsschatz vorhanden und das rund um die Uhr. Nicht zuletzt hängt beispielsweise der Erfolg einer tumorchirurgischen Operation enorm vom Know-how des Operateurs ab. Hier ist ein Haus der Maximalversorgung wie das Uniklinikum Dresden mit seiner großen Expertise immer eine erste Anlaufstelle – sowohl bei Krebs in Früh- aber auch in fortgeschrittenen Stadien. Und: Universitätsklinika leben von der interdisziplinären Zusammenarbeit mit hervorragenden Expertinnen und Experten unterschiedlicher Disziplinen, bei uns sind das Kolleginnen und Kollegen aus der Anästhesie, der Pathologie, der Strahlentherapie, der Radiologie, der Gastroenterologie, der medizinischen Onkologie, der Hämatologie, der Inneren Medizin, der Gynäkologie oder eben auch der Chirurgie anderer Fachdisziplinen und nicht zuletzt der Pflege. Das allein macht es spannend und beeinflusst die Qualität unserer Arbeit enorm positiv.
Wie bewerten Sie die Translationale Medizin am Universitätsklinikum? Lassen sich Forschungsergebnisse schnell und effizient in die Versorgung und Therapie umsetzen? Oder gibt es Nachholbedarf?
Es ist ein enormer Vorteil für die Erkrankten, wenn Krankenversorgung und Forschung eng verknüpft sind und sie im Rahmen von Studien mit innovativen Verfahren und Medikamenten behandelt werden können. Dank der wissenschaftlichen Begleitung des klinischen Alltags wird die Behandlung am Uniklinikum kontinuierlich verbessert. Die Hochschulmedizin ist demnach seit jeher ein Hort für Innovationen. Und das wäre sie nicht, wenn es hier lähmende Prozesse gäbe. Das bestätigt auch die Tatsache, dass Dresden 2015 zweiter Standort des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen geworden ist – die Innovationskraft wird also auch bundesweit positiv bewertet.

Unser Schwerpunkt ist die Krebschirurgie. So entwickelt unser Team um Prof. Dr. Stefanie Speidel Assistenzsysteme, die uns Chirurginnen und Chirurgen sicher und ohne Umwege zum Tumor führen sollen. Benötigt werden diese intelligenten Hilfen unter anderem bei minimalinvasiven Operationen. Hier machen wir einen kleinen Schnitt in die Haut des zu Behandelnden und steuern die Operation über Videobilder des Endoskops. Das Navigationssystem, an dem die Informatikerinnen und Informatiker arbeiten, blendet in die zweidimensionalen Videobilder zusätzliche Informationen ein, wie beispielsweise die dreidimensionale Darstellung der Bereiche, in denen operiert werden soll, oder Gefäße, die nicht verletzt werden dürfen.
Neu und besonders anspruchsvoll ist die Entwicklung solcher Navigationssysteme für Weichgewebe wie im Bauchraum. Denn durch Atmung, Herzschlag oder die Berührung mit medizinischen Instrumenten kann sich die Lage und Form von Geweben und Organen verändern. Diese Veränderungen müssen die Forschenden in Echtzeit analysieren und abbilden. Um das zu erreichen, kombiniert man vor und während der Operation gewonnene Bild- und Sensordaten mit biomechanischen Modellen und entwickelt neue Programme, die aus diesen Informationen Oberflächenveränderungen unmittelbar berechnen können.
Diese beeindruckenden Beispiele stehen dafür, wie wir die in der Forschung gewonnenen Erkenntnisse direkt in die Patientenversorgung implementieren, was ein maximaler potenzieller Vorteil ist.
Sie sind erfahren im Umgang mit dem OP-Roboter „Da Vinci Xi“. Warum ist das Gerät ein Segen sowohl für die zu Behandelnden als auch für die Operierenden?
Unser Ziel ist es, Tumorkranke nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu behandeln und dazu gehört es, dass wir alle Behandlungsoptionen anbieten. Wir haben das Glück, über hochmoderne Medizintechnik zu verfügen, wie eben den „Da Vinci“-OP-Roboter und einen Hybrid-OP. Als Beispiel können wir den Einsatz des „Da Vinci“ bei der operativen Entfernung von Dick- oder Enddarm-Tumoren anschauen. Die Präzision des „Da Vinci“ liefert den Operierenden ein dreidimensionales, hochaufgelöstes und vergrößertes Sichtfeld sowie eine Übersetzung, die aus einer Fünf-Zentimeter-Handbewegung einen zehn Millimeter langen, direkt ausgeführten Schnitt macht. So kann eine vollständige Entfernung des Tumors idealerweise mit der Schonung von für die Lebensqualität wichtigen Strukturen wie beispielsweise Nerven kombiniert werden. Dank des präzisen minimalinvasiven Eingriffs und der in bestimmten Fällen möglichen roboterassistiert angelegten Nahtverbindung am Darm werden Patientinnen und Patienten häufig deutlich schneller wieder mobil und können frühzeitig normale Nahrung zu sich nehmen. Auch wenn ein formaler Beweis der oben genannten Vorteile durch große wissenschaftliche Studien noch aussteht, zeigen sich für uns Klinikerinnen und Kliniker häufig die gewünschten Ergebnisse.

Auch wenn die Operation computergestützt ist: Warum spielt die Erfahrung von Operateurin und Operateur eine große Rolle?
Das ist ein enorm wichtiges Thema, denn diese Erfahrung ist wie eingangs schon erwähnt entscheidend für den Erfolg des Eingriffs. Wir operieren möglichst radikal, aber eben wenn immer möglich funktionserhaltend, und möchten damit die Überlebensraten und Lebensqualität der Patientinnen und Patienten entscheidend erhöhen. Der Einsatz des Operationsroboters und aller modernen Technik ist hilfreich, entscheidend bleiben aber die sehr erfahrenen und sehr gut ausgebildeten Chirurginnen und Chirurgen. Kurzum: Bei der Wahl der Klinik und der von ihr angebotenen Therapie sollten sich die Tumorkranken in einem ersten Schritt an den Patientenzahlen orientieren. Fachverbände wie etwa die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) fordern ebenfalls Mindestfallzahlen, um eine entsprechende Behandlungsqualität sicherzustellen. Allein auf die Zahl der behandelten Patientinnen und Patienten zu schauen, reicht jedoch nicht aus: Erfolgsentscheidend für die Therapie ist auch, dass alle medizinischen Fächer bei jedem Behandlungsfall eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Wie entwickelt sich das Operations-Aufkommen? Bei unserem letzten Gespräch 2019 wurden zwei bis vier roboterassistierte Eingriffe durchgeführt.
Wir haben mittlerweile eine Erfahrung von mehreren Hundert robotischen Operationen und haben insbesondere bei komplexen Operationen – wie bei der Entfernung eines Speiseröhrenkrebses – hervorragende Ergebnisse. Die Pandemie hat uns allerdings ein wenig das Handwerk gelegt, auch wir haben elektive Eingriffe zurückstellen müssen und sind nun gefordert, den Fokus wieder auf die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen zu richten. Nur so können Krebserkrankungen möglichst früh diagnostiziert und behandelt werden. Das Operationsaufkommen ist daher in etwa auf dem Niveau von vor zwei Jahren, auch wenn wir in Teilen deutlich schwerere Fälle sehen, weil Patienten aus Angst vor Infektionen oder durch den Lockdown bedingt, zu spät ihre Ärzte aufgesucht haben. Das ist bitter.
Welche Potenziale bietet Künstliche Intelligenz für die Tumorchirurgie in Ihrem Fachbereich? Es gibt das System CoBot. Worin bestehen die Vorteile bei der Operation? Welcher Erkrankter profitiert davon hauptsächlich? Kommt es bereits zum Einsatz?
Um wieder mit einem Beispiel zu arbeiten: Tumor-Operationen im Bereich des Enddarms erfolgen entlang einer millimeterdünnen Schicht, die an wichtige Nerven grenzt. Werden diese geschädigt, kann dies zu Inkontinenz und Störungen der Sexualfunktion führen. In Teams entwickeln wir am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden und am Else Kröner Fresenius Zentrum für Digitale Gesundheit für diesen Bedarf das computerbasierte Assistenzsystem „CoBot“, das das Risiko für solche Komplikationen mithilfe Künstlicher Intelligenz deutlich senken soll. In der Anwendung sehen die Chirurginnen und Chirurgen während der Operation beim Blick auf den Monitor wie gewohnt die Kamerabilder aus dem Bauchraum des zu Operierenden. Bei Bedarf soll das System in die Kamerabilder weitere Informationen einblenden: etwa die Lage wichtiger Nerven oder die optimale Schnittlinie. Besonders wichtig ist, dass die richtige Information zur richtigen Zeit zur Verfügung steht. Der Operierende trifft jederzeit selbst die Entscheidungen. Das System unterstützt ihn nur, ähnlich wie ein Navigationssystem im Auto. Bereits im kommenden Jahr soll das neu entwickelte System im Rahmen einer Studie bei realen Operationen getestet werden.

Mit welchen Fortschritten ist in Ihrem Fachgebiet zu rechnen und inwieweit steht das in Abhängigkeit von technischen Entwicklungen?
Es wird maßgeblich an der technischen Infrastruktur geforscht, die es den Operierenden ermöglichen soll, noch präziser und unter Reduktion aller menschlichen Fehler zu operieren. Hinzu kommt eben, wie oben schon skizziert, die Künstliche Intelligenz als unterstützendes Element für die Operation zum Beispiel bei schwer zugänglicher oder sehr individueller Tumorerkrankung.
Warum ist Teamwork bei Ihren Operationen so wichtig? Inwieweit spielt ein angenehmes Arbeitsumfeld unter mitunter stressigen Bedingungen eine Rolle?
Wie schon geschildert ist eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit in allen Professionen und Berufsgruppen der Schlüssel zu einer möglichst hohen Behandlungsqualität. Und dazu bedarf es gut eingespielter Teams, die sich aufeinander verlassen können. Ich persönlich genieße jeden Tag die sehr enge Zusammenarbeit mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sowie der Pflege. Wenn man jeden Tag im wahrsten Sinne lebenswichtige Entscheidungen trifft, dann ist es wunderbar ein solch hervorragendes Team an der Seite zu wissen. Selbstverständlich ist das nur eine Dimension, denn hinzu kommt die Infrastruktur, die wir durch zahlreiche bauliche Investitionen, wie das Chirurgische Zentrum, deutlich verbessern konnten. Ich persönlich bin beeindruckt, was sich hier in Dresden in den letzten Jahren bewegt hat, hier gebührt dem Vorstand des Universitätsklinikums und dem Freistaat ein großer Dank. Und ja – Stress ist tatsächlich ein Faktor, der in unserem Feld oftmals vorkommt, aber auch dagegen entwickelt man im Laufe der Jahre eine gewisse Resilienz. Denn eines ist sicher: Dieser Job ist zumindest mein Traumjob, den ich als enorm erfüllend empfinde und auch das möchte ich dem ärztlichen Nachwuchs vermitteln.
Interview: Philipp Demankowski