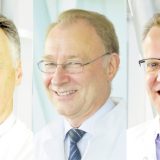Dem Tumor auf der Spur
Leistungsfähige Magnetresonanztomographen (MRT) haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Neuroradiologie zu einem eigenständigen Schwerpunkt der Radiologie entwickelt hat. In der Krankenversorgung profitieren zum Beispiel Patienten mit Hirntumoren von der Methode und ihren vielfältigen Möglichkeiten. Mit diesem Verfahren lassen sich nicht nur strukturelle Einblicke in das Gehirn erzielen, sondern auch Aussagen treffen zur Funktion von bestimmten Hirnarealen, zur Durchblutung des Gewebes sowie zur Konzentration von Stoffwechselprodukten im Verlauf krankhafter Prozesse. Diese sogenannten Metabolite lassen sich mit der MR-Spektroskopie darstellen und erlauben beispielsweise weiterreichende Aussagen über die individuelle Beschaffenheit von Hirntumoren.
Impulse auch für die Hirnforschung
Neben der klinischen Patientenversorgung hat auch die Hirnforschung durch die Magnetresonanztomographie (MRT) entscheidende Impulse bekommen. Zusätzlich zur Neurologie und Neurochirurgie sind es hier vor allem die psychiatrischen Fächer, die von diesem, die Probanden nicht belastenden Verfahren profitieren. Damit Wissenschaftler das Potenzial dieser Bildgebung optimal nutzen können, hat die Hochschulmedizin Dresden einen 3-Tesla-Magnetresonanztomographen ausschließlich für Forschungszwecke in Betrieb genommen.
Exakter Nachweis von Tumoren
Dank der modernen Verfahren in der Neuroradiologie können Mediziner heute Hirntumore sehr gut diagnostizieren, anatomisch exakt lokalisieren und bereits nicht invasiv weitreichende Aussagen zur Art des Tumors treffen.
Detailreiche Darstellung von Hinstrukturen
Bei der MRT handelt es sich um eine sichere, nichtinvasive Untersuchungsmethode, die ohne Röntgenstrahlen oder radioaktive Substanzen auskommt. Starke Magnetfelder und Radiowellen regen die Wassermoleküle im menschlichen Körper an. Daraufhin senden diese entsprechende Signale aus, die anschließend empfangen und sich mit Hilfe eines leistungsstarken Computers zu aufschlussreichen Bildern verarbeiten lassen. Dank der Veränderung bestimmter Messparameter durch die Neuroradiologen können das Gewebe unterschiedlich angeregt und verschiedene MRT-Sequenzen aufgenommen werden. So entstehen detailreiche Ansichten, die die komplexe Anatomie der Hirnstrukturen sehr genau darstellen. Andere Methoden, beispielsweise die auf Röntgenstrahlen beruhende Computertomographie, erlauben solche Untersuchungsergebnisse nicht in derselben Qualität.
Langfristige Partnerschaft mit Siemens
Mit einer langfristig angelegten strategischen Partnerschaft des Dresdner Uniklinikums mit Siemens Healthineers wurde Ende 2017 eine enge technische und inhaltliche Forschungskooperation für die gemeinsame Evaluierung und Weiterentwicklung neuer Methoden der Bildgebung sowie neuer Therapieansätze vereinbart. Neben dem Schwerpunkt Tumorforschung liegt ein weiterer Fokus des Uniklinikums im Bereich der neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen sowie der Vernetzung von neurowissenschaftlichen Arbeitsgruppen. Dafür existiert in der Hochschulmedizin Dresden eine einzigartige Konstellation eng zusammenarbeitender Institute – von der Kinder- und Jugendpsychiatrie über die Psychiatrie und Psychotherapie bis hin zur Neurologie, Neurochirurgie und Neuroradiologie.
Breite Studienpalette dank Forschungs-MRT
Das Institut für Neuroradiologie, das über insgesamt drei neue 3-Tesla-MRT-Systeme für klinische Untersuchungen und Forschungszwecke verfügt – darunter ab Herbst 2018 ein intraoperativer MRT im neuen Haus 32 – verspricht sich viel von der Zusammenarbeit mit Siemens: „Das Universitätsklinikum hat einen dezidierten Schwerpunkt in der Neurowissenschaft. Es ist unser Ziel, mit neuer Ausstattung und interdisziplinären Strukturen international noch sichtbarer zu werden“, sagt Institutsdirektorin Prof. Dr. Jennifer Linn. Die Palette der dank des Forschungs-MRT initiierten wissenschaftlichen Projekte umfasst u.a. Studien zur Multiplen Sklerose, zu zerebrovaskulären Erkrankungen und zur Untersuchung von Therapieansprechen und Therapiefolgen moderner Krebstherapien. Da die Behandlung von Hirntumoren und -metastasen mit Medikamenten wie auch Strahlung nicht nur Krebsgewebe verändert, sondern auch gesundes Gewebe, ist es im Sinne einer verlässlichen Diagnostik entscheidend, diese Unterschiede erkennen zu können. Das ist dank der neuen Ausstattung möglich.
MR-Spektroskopie liefert biochemische Informationen
In den vergangenen Jahrzehnten erweiterte sich das Spektrum der neuroradiologischen Diagnostik auf dem Gebiet der Tumordiagnostik erheblich. Anfangs ließen sich mit dem MRT lediglich Form und Lage eines Tumors feststellen. Dank moderner MRT-Methoden, wie beispielsweise der Magnetresonanz-Spektroskopie, ist es heute möglich, detailliertere Informationen zu der Tumorart und dem Grad der Bösartigkeit zu erhalten. Mit der MR-Spektroskopie lassen sich Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper beobachten. Im Ergebnis liefert der Tomograph jedoch keine Bilder, sondern biochemische Informationen in Form von sogenannten Metabolitenmustern, die als Spektren dargestellt werden. Das Prinzip der Methode ist das gleiche wie das der MR-Bildgebung. Während die Neuroradiologen dort allerdings die Protonen des Wassers beobachten – sie haben einen Anteil von rund 60 Prozent am Körpergewebe – stehen bei der MR-Spektroskopie die Protonen bestimmter Stoffwechselprodukte – sogenannter Metaboliten – im Mittelpunkt. Die größte Herausforderung stellt deren vergleichsweise geringe Konzentration dar. Sie ist etwa 10.000 Mal kleiner als die der Protonen des Wassers. Deshalb ist es erforderlich, den MR-Scanner vor jeder Messung zusätzlich zu eichen.
Verhältnis der Metabolite weisen auf bestimmte Krankheiten hin
Durch die MR-Spektroskopie lassen sich Daten über die Konzentration einzelner Metabolite gewinnen, die im gesunden Gehirn in bestimmten Verhältnissen vorliegen. Weichen diese Konzentrationsverhältnisse von der Norm ab, kann dies Hinweise auf ein ganz bestimmtes Krankheitsbild geben. Beispielsweise kennzeichnet ein Rückgang von N-Acetylaspartat als neuronalem Marker den Untergang von Hirnsubstanz. Die erhöhte Konzentration von Cholin hingegen weist auf Prozesse hin, bei denen ein erhöhtes Zellwachstum des Hirngewebes stattfindet, wie dies bei einem Tumor der Fall ist. Aktuelle methodische Verbesserungen erlauben es sogar, erste molekulargenetische Charakteristika von Gliomen, der häufigsten Form hirneigener Tumoren, in vivo nachzuweisen: Mit der sogenannten IDH-MR-Spektroskopie lässt sich ein Stoffwechselprodukt nachweisen, das nur in einer Unterform der Gliome vorkommt. Diese speziellen Tumoren haben eine vergleichsweise bessere Prognose als die Gliome ohne diese Veränderung.
Text: UKD