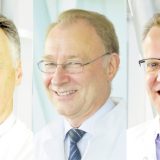Schnell behandeln nach dem Ampelprinzip
Das Haus 32 bietet der chirurgischen Notaufnahme optimale Bedingungen für eine effiziente Versorgung – zum Wohle der Patienten.
Die chirurgische Notaufnahme stellt mit insgesamt 35.000 Patienten pro Jahr den größten Notfallbereich des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus dar. Als Universitätsklinik mit verschiedensten Zentren, wie dem überregionalen Traumazentrum, Level-1 Wirbelsäulenzentrum, Kinderpolytraumazentrum, Replantationszentrum und vielen mehr, nimmt die chirurgische Notaufnahme eine Schlüsselrolle in der notfallmedizinischen Versorgung der Menschen in Dresden und Ostsachsen ein. „Unser Schwerpunkt liegt vor allem auf der Schwerstverletztenversorgung im Rahmen des überregionalen Traumazentrums”, erklärt Katja Mühle, die als Funktionsbereichsleiterin der chirurgischen Notaufnahme am Universitätsklinikum Dresden viele Fäden in der Hand hält. Das hohe Patientenaufkommen kommt alleine schon durch die Tatsache zustande, dass die Notaufnahme an allen Tagen im Jahr 24Stunden geöffnet hat, aber auch weil sie explizit ein Behandlungsspektrum aufweist, dass Krankheitsbilder aller chirurgischen Fachdisziplinen umfasst. Von der Unfall- über die Kinder- bis zur Neurochirurgie – um nur einige der Teildisziplinen zu nennen. „Damit sind wir der größte Notfallbereich am Universitätsklinikum“, sagt der ärztliche Leiter PD Dr. Christian Kleber.

v.l.: Katja Mühle (Funktionsbereichsleiterin der chirurgischen Notaufnahme), Dr. Anne Osmers (geschäftsführende Leiterin der chirurgischen Notaufnahme) und Privatdozent Dr. Christian Kleber (Ärztlicher Leiter der chirurgischen Notaufnahme) / Foto: Foto: Universitätsklinikum Dresden/Thomas Albrecht
Verdopplung der Behandlungsplätze
Nachdem die Notaufnahme im Haus 58 ohnehin nur eine provisorische Heimat gefunden hat, stoßen die entsprechende Infra-struktur und die Belastbarkeit der Mitarbeiter inzwischen an ihre Grenzen. Natürlich wird man sich auch im Haus 32 über mangelnde Patientenzahlen nicht beschweren müssen, zumal am neuen Standort zusätzlich noch die Notfallversorgung der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde integriert wird. Um diese Herausforderungen zu meistern, wird sowohl das Personal aufgestockt als auch die medizinisch-technische Ausstattung entscheidend verbessert. „Wir haben dann doppelt so viele Behandlungsplätze wie am alten Standort“, sagt Katja Mühle, die von Anfang an in die bauliche Konzeptionierung involviert war.
Räumliche Trennung nach Grad der Verletzungsschwere
Um den unterschiedlichen Ansprüchen eines so breiten Behandlungsspektrums besser gerecht zu werden, setzen die Mediziner auf das sogenannte Manchester-Triage-System. Dabei handelt es sich um ein standardisiertes Verfahren zur Ersteinschätzung der Patienten in der Notaufnahme, so dass eine Differenzierung nach Grad der Schwere der Verletzung und Erkrankung möglich wird. Mit dem System ist es viel einfacher und transparenter, die Behandlungsprioritäten einzuschätzen. „Wir erkennen dadurch viel schneller, bei welchen Patienten die Verletzungen so schnell es geht behandelt werden müssen“, sagt Anne Osmers, geschäftsführende Leiterin der chirurgischen Notaufnahme. Für die Patienten wird die Kategorisierung durch eine räumliche Trennung bemerkbar, die zusätzlich durch eine unterschiedliche und alltagsverständliche Farbgebung verdeutlicht wird.
Die Notaufnahme besteht im Haus 32 deshalb aus den drei verschiedenen Bereichen Rot, Gelb und Grün. Schwerverletzte und akute Notfälle mit Lebensgefahr werden im roten Bereich versorgt. Überwachungspflichtige Patienten sind im gelben und Leichtverletzte im grünen Bereich untergebracht. Die Patientengruppen kommen dabei nicht miteinander in Kontakt, was eine effiziente, sorgfältige und der Verletzung angemessene Behandlung ermöglicht. In Deutschland wurde das Manchester-Triage-System 2008 zum ersten Mal an der Berliner Charité in einer Universitätsklinik eingeführt.
Kurze Wege für schnelle Behandlungsoptionen
Von dort kam 2015 PD Dr. Christian Kleber nach Dresden. Der ärztliche Leiter in der chirurgischen Notaufnahme kennt die Vorteile des Systems und konnte seine Expertise bei der Bauplanung mit einbringen. Die neue Raumstruktur geht einher mit dem Prinzip der kurzen Wege, das dem Baugeschehen im Haus 32 ohnehin zugrunde liegt und das für eine optimierte Logistik im Klinikalltag sorgt. Ein Aspekt betrifft dabei die Luftrettung, die in der Notfallchirurgie eine bisweilen lebensentscheidende Rolle spielt. Zwar befindet sich der Hubschrauberlandeplatz weiterhin auf dem Dach des benachbarten Hauses 59. Über eine Brücke und einen Fahrstuhl sind die beiden Gebäude direkt miteinander verbunden, so dass die Patienten vom Landeplatz aus direkt in den Schockraum gebracht werden können. „Bisher mussten die Patienten noch durch die Gänge geschoben werden“, erklärt Dr. Anne Osmers. Im Planungsprozess wurden auch die Erfahrungen vergleichbarer Neubauvorhaben genutzt. Die Anordnung von getrennten mehreren Behandlungs- bzw. Überwachungsplätzen direkt am administrativen Stützpunkt der chirurgischen Notaufnahme bietet sowohl den Patienten das Gefühl der Betreuung als auch dem Pflegepersonal die Sicherheit der notwendigen Überwachung der Patienten.
Effizientes Einbahnstraßensystem
Verbessert hat sich auch die Wegeführung generell. Konnten am alten Standort nur die Teams aus zwei Rettungswagen parallel die Patienten dem Team der chirurgischen Notaufnahme übergeben, gibt es im Haus 32 insgesamt sieben Stellplätze für die Fahrzeuge. Die Rettungswagen können eigenständig an- und abfahren, ohne dass ein parallel agierendes Fahrzeug rangieren muss. Zudem gibt es eine strikte Trennung zwischen den Selbstvorsteller-Patienten und jenen, die mit dem Rettungswagen ankommen. Auch im Haus selber wird ein Einbahnstraßensystem etabliert. Patienten auf dem Weg ins Behandlungszimmer treffen dabei nicht auf jene Patienten, die bereits untersucht wurden. Engstellen werden so vermieden. Im großzügigen Wartebereich mit 64 Plätzen können die Patienten über einen Monitor sehen, wie lange sie sich noch gedulden müssen. Gleichzeitig überwacht ein Sicherheitsdienst an einer festen Position das Geschehen. Die Maßnahmen sind notwendig, da in der Vergangenheit leider Übergriffe auf das Personal der CNA vorkamen. Für den Ernstfall verfügt die chirurgische Notaufnahme im neuen Operativen Zentrum daher über ein entsprechendes Sicherheitskonzept.
Schnelle Umstellung auf Katastrophenbetrieb
Ein wichtiger Aspekt bei der Planung war die schnelle Anpassung der chirurgischen Notaufnahme im Katastrophenfall. „Angesichts der allgemeinen Sicherheitslage sowie der Zunahme von Massenunfällen und Katastrophen wollten wir uns ganz bewusst für diese Fälle wappnen, um der Lage schnell und so gut es geht Herr zu werden“, sagt PD Dr. Christian Kleber. Die Umstellung der Notaufnahme auf einen solchen Extremfall wurde dabei so konzipiert, dass der reguläre Betrieb weiterlaufen kann. Neu integriert ist etwa eine Dekontaminationseinheit und ein eigener Zugang für die Katastrophenopfer durch eine Schleuse, so dass eventuell infizierte Patienten mit den regulären Patienten nicht in Kontakt kommen. Auch die Einsatzleitung für die Bewältigung der Katastrophe wird zukünftig von einem eigenen Raum im Haus 32 gesteuert.
Modernste medizintechnische Ausstattung
Die medizintechnische Ausstattung im Haus entspricht höchsten Standards. Im roten Bereich stehen unter anderem zwei speziell ausgestattete Schockräume für schwerverletzte und polytraumatisierte Patienten zur Verfügung. Einer dieser Reanimierungsräume hat eine Doppelfunktion und kann im Bedarfsfall schnell und unkompliziert in einen Not-Operationssaal verwandelt werden. Für die Radiologie steht ein Computertomograf im Raum direkt neben dem Schockraum. „Für Polytraumen ist die Computertomografie das entscheidende bildgebende Verfahren. Am alten Standort mussten wir den Patienten nach der Erstsichtung erst in die Radiologie bringen, um die Aufnahmen am Computertomograf zu machen. Das ist nun glücklicherweise nicht mehr nötig“, sagt Dr. Anne Osmers. „Das spart Zeit und ist ein deutlicher Sicherheitsfaktor.“
Interdisziplinarität hat Methode
Ein handlungsleitendes Prinzip bei der Planung war die Einbeziehung der jeweiligen Fachdisziplinen, deren Mitarbeiter die in der Notfallambulanz aufgenommen Patienten weiter versorgen. Diese Interdisziplinarität hat Methode am Universitätsklinikum Dresden. In enger Abstimmung mit dem UniversitätsCentrum für Gesundes Altern wurde beispielsweise ein abgeschirmter Raum für die Behandlung geriatrischer Patienten geschaffen. Und manchmal müssen Angehörige dort auch Abschied zu nehmen. „Die psychosoziale Nachsorge hat bei uns eine hohe Priorität. Wir betrachten das Thema mit größter Sorgfalt“, sagt PD Dr. Christian Kleber. Natürlich verlangt auch die Behandlung von Kindern eine hohe Sensibilität. Um diese zu gewährleisten, setzt man im neuen Haus 32 auf separate Bereiche für die Kinder- und Erwachsenennotfallchirurgie. Es gibt einen eigenen Wartebereich für die jungen Patienten mit einer Spiel- sowie einer Stillecke und auch einen Kindergipsraum. Einer der beiden Schockräume ist zudem kinderspezifisch ausgestattet. Generell wurde der Neubau von Haus 32 an den Richtlinien der Uniklinik für eine Zentralisierung der Notfallmedizin orientiert. Bereits beim Haus 59 wurde auf die räumliche Nähe von OP und Patientenversorgung geachtet. Mit dem Umzug der chirurgischen Notaufnahme in das neue Haus 32 ist einer der letzten Schritte in diese Richtung getan, auch weil die Hals-, Nasen-, Ohrenklinik nun mit der Notaufnahme verbunden ist.
Text: Philipp Demankowski